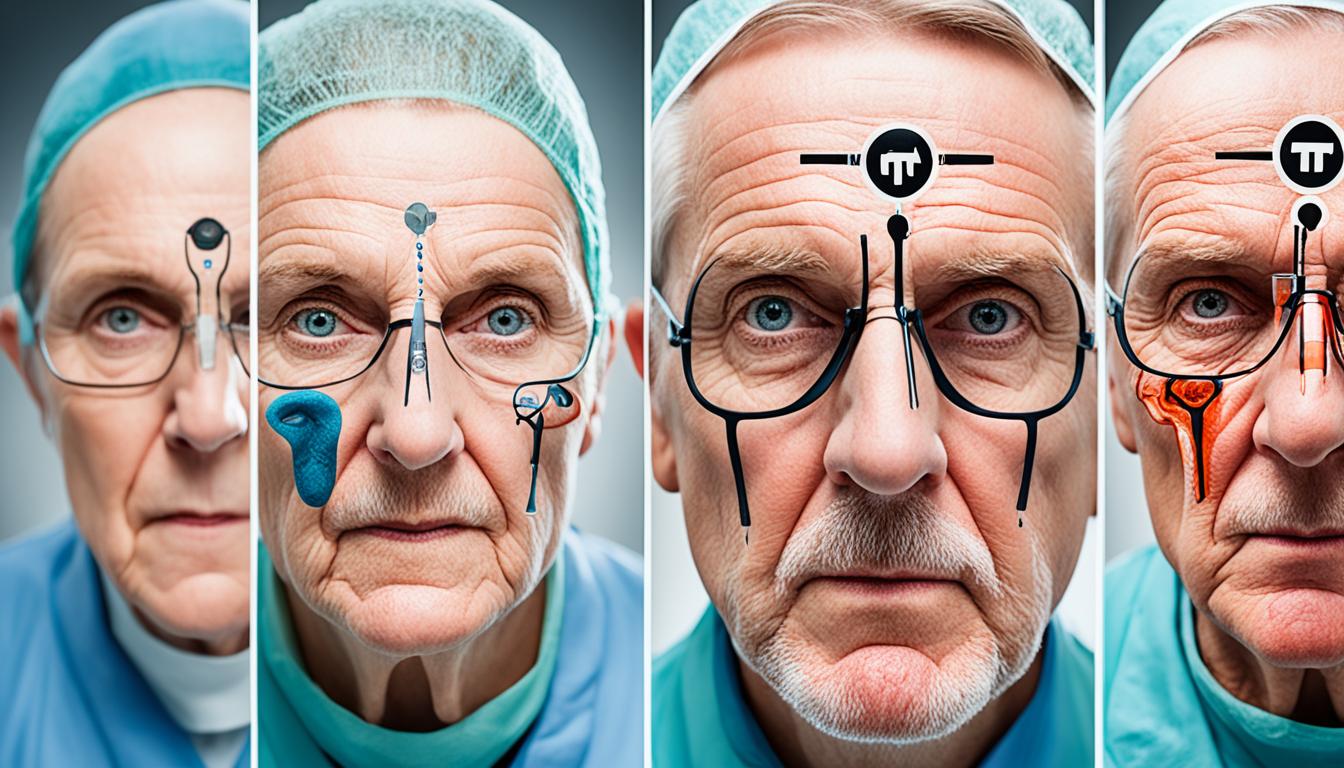Wussten Sie, dass die Berechnung des Grad der Behinderung (GdB) in Deutschland sich auch auf Personen mit mehrfachen Behinderungen bezieht? Das Versorgungsrecht in Deutschland legt fest, wie der GdB bewertet wird und welche Auswirkungen dies auf das Leben in der Gesellschaft hat. Dieser Artikel wird Ihnen Einblicke in die Berechnung des Gesamt-GdB bei mehrfachen Behinderungen geben und warum dies für betroffene Personen so wichtig ist.
Haupterkenntnisse
- Die Berechnung des Gesamt-GdB erfolgt nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen.
- Die individuelle Bewertung der verschiedenen Funktionsbeeinträchtigungen ist entscheidend.
- Die einzelnen GdB-Werte werden nicht einfach addiert, sondern in ihrer Gesamtheit bewertet.
- Weitere Funktionsstörungen können den Gesamt-GdB beeinflussen, wenn sie sich gegenseitig verstärken.
- Es ist empfehlenswert, die gutachtliche Stellungnahme durch Fachkundige überprüfen zu lassen.
Das Versorgungsrecht und die Bewertung des GdB
Das Versorgungsrecht in Deutschland ist von großer Bedeutung für die Berechnung des Grades der Behinderung (GdB). Es legt fest, nach welchen Kriterien der GdB bewertet wird und welche Auswirkungen die Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft haben muss.
Die Bewertung des GdB erfolgt nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen, die in der Versorgungs-Medizin-Verordnung (VersMedV) festgehalten sind. Diese Grundsätze stellen sicher, dass die Bewertung objektiv und nachvollziehbar durchgeführt wird.
Die Bewertung des GdB erfolgt nicht durch eine einfache Addition der einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen, sondern durch eine Gesamtbetrachtung. Es kommt also nicht nur auf die Einzelwerte der Behinderungen an, sondern vor allem auf ihre Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Um einen GdB festzustellen, muss ein Wert von mindestens 20 erreicht werden. Eine genaue Berechnung erfolgt anhand der jeweiligen Beeinträchtigungen und ihrer Auswirkungen. Dabei werden die einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen nicht einfach addiert, sondern in ihrer Gesamtheit bewertet.
Bewertung nach Versorgungsmedizinischen Grundsätzen
Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze sind ein wichtiger Leitfaden für die Bewertung des GdB. Sie stellen sicher, dass die Bewertung einheitlich und nach objektiven Maßstäben erfolgt. Die Grundsätze legen fest, wie die Auswirkungen der Behinderungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bewertet werden und welche Kriterien dabei eine Rolle spielen.
Bei der Bewertung werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, wie zum Beispiel die körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Beeinträchtigungen. Auch der Schweregrad der Funktionsbeeinträchtigungen und die Dauerhaftigkeit der Behinderungen spielen eine Rolle.
Die Bewertung erfolgt in Form eines Gesamt-GdB, der das Ausmaß der Behinderung widerspiegelt. Dieser Wert hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Rentenansprüche und den Schwerbehindertenausweis.
Beispiel einer Bewertung des GdB nach Versorgungsmedizinischen Grundsätzen:
| Behinderung | GdB-Wert |
|---|---|
| Beeinträchtigung des Bewegungsapparates | 30 |
| Schwerhörigkeit | 20 |
| Konzentrationsstörungen | 10 |
| Gesamt-GdB | 40 |
Im oben genannten Beispiel ergibt sich ein Gesamt-GdB-Wert von 40 durch die Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen. Die Funktionsbeeinträchtigung des Bewegungsapparates hat den höchsten Einzelwert und wird daher als führende Behinderung berücksichtigt. Die anderen Beeinträchtigungen haben ebenfalls Auswirkungen auf den Gesamtwert, werden aber nicht einfach addiert, sondern in einer Gesamtbetrachtung bewertet.
Mit einem Gesamt-GdB von 40 könnte die Person in diesem Beispiel bestimmte Rentenansprüche geltend machen und einen Schwerbehindertenausweis beantragen.
Bewertung mehrerer Behinderungen in ihrer Gesamtheit
Bei der Bewertung mehrerer Behinderungen ist es wichtig, diese in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dabei wird berücksichtigt, wie sich die verschiedenen Beeinträchtigungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft auswirken. Es werden nicht einfach die Einzelwerte der Funktionsbeeinträchtigungen addiert, sondern die wechselseitigen Beziehungen und Auswirkungen der einzelnen Behinderungen berücksichtigt.
Die Bewertung basiert auf einer Gesamtbetrachtung der verschiedenen Beeinträchtigungen und deren Einfluss auf den Grad der Behinderung (GdB). Dabei haben die einzelnen GdB-Werte keine eigenständige Bedeutung, sondern dienen als Messgrößen für die Gesamtbewertung des GdB.
Um dies zu veranschaulichen, ist hier eine Tabelle, die die Bewertung mehrerer Behinderungen verdeutlicht:
| Funktionsbeeinträchtigung | GdB-Wert |
|---|---|
| Sehbehinderung | 30 |
| Gehbehinderung | 20 |
| Hörbehinderung | 20 |
| Psychische Beeinträchtigung | 40 |
In diesem Beispiel werden mehrere Behinderungen bewertet, darunter eine Sehbehinderung, Gehbehinderung, Hörbehinderung und psychische Beeinträchtigung. Die einzelnen GdB-Werte werden nicht einfach addiert, sondern durch eine Gesamtbetrachtung der Auswirkungen und wechselseitigen Beziehungen bewertet.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Bewertung mehrerer Behinderungen individuell und im Einzelfall erfolgt. Die genaue Berechnung des Gesamt-GdB basiert auf den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen und sollte von Fachleuten vorgenommen werden, um eine korrekte Bewertung zu gewährleisten.

Die Gesamtbewertung mehrerer Behinderungen berücksichtigt die Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und ermöglicht eine gerechte Bewertung des Grad der Behinderung (GdB).
Berechnung des Gesamt-GdB
Bei der Berechnung des Gesamt-GdB wird zunächst die Funktionsbeeinträchtigung mit dem höchsten Einzelwert, auch bekannt als “führende Behinderung”, berücksichtigt. Anschließend wird geprüft, ob und inwieweit sich durch weitere Funktionsbeeinträchtigungen das Ausmaß der Behinderung vergrößert. Dabei werden die einzelnen GdB-Werte nicht einfach addiert, sondern die Berechnung erfolgt auf Grundlage einer Gesamtbetrachtung.
Um den Gesamt-GdB zu ermitteln, werden die Auswirkungen jeder Funktionsbeeinträchtigung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bewertet. Hierbei spielen die Art, Schwere und Dauer der Beeinträchtigungen eine Rolle. Es wird geprüft, inwiefern sich die einzelnen Behinderungen gegenseitig beeinflussen und verstärken. Die Berechnung erfolgt somit nicht rein mathematisch durch die Addition der einzelnen GdB-Werte, sondern durch eine umfassende Einschätzung der Gesamtsituation.
Ein Beispiel für die Berechnung des Gesamt-GdB:
| Funktionsbeeinträchtigung | GdB-Wert |
|---|---|
| Funktionsbeeinträchtigung A | 30 |
| Funktionsbeeinträchtigung B | 20 |
| Funktionsbeeinträchtigung C | 10 |
In diesem Fall würde die “führende Behinderung” Funktionsbeeinträchtigung A mit einem GdB-Wert von 30 berücksichtigt. Anschließend wird geprüft, ob die anderen Funktionsbeeinträchtigungen (B und C) das Ausmaß der Behinderung weiter vergrößern. Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass die Behinderungen B und C keine signifikante zusätzliche Einschränkung mit sich bringen, bleibt der Gesamt-GdB bei 30. Die einzelnen GdB-Werte werden nicht einfach addiert, sondern die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Gesamtbetrachtung.
Die Berechnung des Gesamt-GdB ist komplex und erfordert eine individuelle Einschätzung. Hierbei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, wie die Art und Schwere der Behinderungen, ihre Auswirkungen auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und ihre wechselseitigen Beziehungen. Daher ist es wichtig, bei der Feststellung des Gesamt-GdB alle relevanten Informationen anzugeben und gegebenenfalls ärztliche Nachweise vorzulegen.
Hinweis:
Aufgrund der Komplexität der Berechnung empfiehlt es sich, bei Unsicherheiten oder Streitigkeiten eine gutachterliche Stellungnahme der zuständigen Behörde durch Fachkundige überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass der Grad der Behinderung korrekt ermittelt wurde.

Auswirkungen weiterer Funktionsstörungen auf den Gesamt-GdB
Das Vorliegen weiterer Gesundheitsstörungen mit einem GdB von mindestens 20 führt nicht automatisch zu einer Erhöhung des Gesamt-GdB. Die Bewertung erfolgt nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen. Es erfolgt keine automatische Erhöhung des Gesamt-GdB aufgrund zusätzlicher Behinderungen.
Wechselwirkung und Verstärkung der Behinderungen
Im Rahmen der Bewertung des Grads der Behinderung (GdB) wird geprüft, ob sich die einzelnen Behinderungen gegenseitig verstärken und ungünstig beeinflussen. Es kommt darauf an, ob die Funktionsstörungen in wechselseitiger Beziehung zueinander stehen und zu einer Verschlimmerung der Behinderung führen. Diese Wechselwirkung der Behinderungen wird bei der Berechnung des GdB berücksichtigt, um eine angemessene Bewertung vorzunehmen.
Ein Beispiel für die Verstärkung des GdB durch die Wechselwirkung von Behinderungen ist eine Funktionsstörung der Lendenwirbelsäule in Verbindung mit einer Funktionsstörung der Kniegelenke. Durch diese Kombination kann es zu einer Verschlimmerung der Behinderung kommen, da sich die Beeinträchtigungen gegenseitig verstärken. In solchen Fällen wird der GdB entsprechend angepasst, um die Auswirkungen der beeinträchtigenden Funktionsstörungen angemessen zu berücksichtigen.
Es gibt jedoch auch Situationen, in denen sich die Behinderungen nicht gegenseitig verstärken. In solchen Fällen wird der GdB auf Basis der individuellen Auswirkungen der einzelnen Behinderungen bewertet, ohne dass eine Verstärkung durch die Wechselwirkung erfolgt. Die Bewertung bleibt dabei objektiv und berücksichtigt die individuelle Situation des Betroffenen.

Die Wechselwirkung und Verstärkung der Behinderungen spielt eine wichtige Rolle bei der Festlegung des GdB. Durch die Berücksichtigung dieser Aspekte kann eine realistische und gerechte Bewertung des Grades der Behinderung erfolgen, die den individuellen Bedürfnissen und Beeinträchtigungen gerecht wird.
Gutachtliche Stellungnahme und Überprüfung
Die Bewertung des GdB erfolgt durch eine gutachtliche Stellungnahme der zuständigen Behörde. Es handelt sich dabei um eine fundierte Beurteilung des individuellen Grades der Behinderung. Um sicherzustellen, dass die Bewertung korrekt und fair erfolgt, ist es empfehlenswert, die gutachtliche Stellungnahme von Fachkundigen überprüfen zu lassen.
Ein kompetenter Ansprechpartner hierfür ist der DGB Rechtsschutz vor Ort. Die Experten des DGB Rechtsschutzes sind mit den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen bestens vertraut und können die Stellungnahme auf ihre Richtigkeit prüfen. Eine Überprüfung durch Fachkundige kann dabei helfen, eventuelle Fehler oder Ungereimtheiten aufzudecken und gegebenenfalls Einspruch einzulegen.
Die Bewertung des GdB ist ein komplexer Prozess, der von vielen individuellen Faktoren abhängt. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte und Auswirkungen der Behinderung in der gutachtlichen Stellungnahme berücksichtigt und richtig bewertet werden.
Es ist empfehlenswert, die gutachtliche Stellungnahme von Fachkundigen überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass der GdB korrekt bewertet wurde.
Die Überprüfung der gutachtlichen Stellungnahme kann auch hilfreich sein, um mögliche Einspruchsmöglichkeiten zu identifizieren und den Grad der Behinderung gegebenenfalls anzupassen. Denn die Höhe des GdB kann einen erheblichen Einfluss auf Ansprüche und Leistungen haben.
| Warum die Überprüfung der gutachtlichen Stellungnahme wichtig ist: |
|---|
| Ermittlung eventueller Fehler oder Ungereimtheiten |
| Identifizierung von Einspruchsmöglichkeiten |
| Anpassung des GdB bei Bedarf |
Eine fachkundige Überprüfung der gutachtlichen Stellungnahme kann dabei helfen, den Grad der Behinderung korrekt festzustellen und gegebenenfalls eine Neubewertung zu beantragen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die Bewertung des GdB immer vom Einzelfall abhängt. Jeder Fall ist einzigartig und erfordert eine individuelle Bewertung. Eine gutachtliche Stellungnahme sollte daher sorgfältig geprüft werden, um mögliche Fehler oder Unstimmigkeiten zu vermeiden.

Die Überprüfung der gutachtlichen Stellungnahme durch Fachkundige ist daher eine gute Möglichkeit, sicherzustellen, dass der GdB korrekt ermittelt wurde. Insbesondere bei komplexen Fällen oder bei Unstimmigkeiten empfiehlt es sich, fachkundigen Rat einzuholen.
Relevante Informationen zum Grad der Behinderung
Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Deutschland zwischen 20 und 100 in Zehnerschritten gestaffelt. Dabei gilt eine Behinderung ab einem GdB von 50 als Schwerbehinderung. Die Bestimmung des GdB erfolgt durch ärztliche Gutachter auf Antrag. Die Bewertung erfolgt nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen, die die Auswirkungen der Behinderung auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft berücksichtigen.
Der Schwerbehindertenausweis kann auch nachträglich beantragt werden, jedoch muss der Schwerbehindertenstatus am Tag des Rentenbeginns vorliegen. Es ist daher ratsam, den Antrag rechtzeitig zu stellen, um von den damit verbundenen Vorteilen und Unterstützungsleistungen profitieren zu können.
Ein Schwerbehindertenausweis bietet verschiedene Vergünstigungen, wie zum Beispiel Steuererleichterungen, besondere Kündigungsschutzregelungen sowie Anspruch auf Zusatzurlaub. Zudem ermöglicht er den Zugang zu speziellen Angeboten und Leistungen, die Menschen mit Behinderungen unterstützen und ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verbessern sollen.
Wenn Sie Fragen zur Beantragung des Schwerbehindertenausweises oder zur Berechnung des GdB haben, können Sie sich an entsprechende Beratungsstellen oder an den DGB Rechtsschutz vor Ort wenden.

Zusammenfassung:
- Der Grad der Behinderung (GdB) wird in Zehnerschritten von 20 bis 100 gestaffelt.
- Ab einem GdB von 50 gilt eine Behinderung als Schwerbehinderung.
- Der GdB wird auf Antrag durch ärztliche Gutachter nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen bestimmt.
- Der Schwerbehindertenausweis kann auch nachträglich beantragt werden, muss aber am Tag des Rentenbeginns vorliegen.
- Der Schwerbehindertenausweis bringt verschiedene Vergünstigungen und Unterstützungsleistungen mit sich.
“Die Anerkennung einer Behinderung und die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises können Menschen mit Behinderungen dabei unterstützen, ihre Rechte wahrzunehmen und eine verbesserte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.”
Fazit
Die Berechnung des Gesamt-GdB bei mehrfachen Behinderungen nach dem Versorgungsrecht in Deutschland ist ein komplexer Prozess, der von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, alle relevanten Faktoren und Auswirkungen anzugeben und Nachweise von den behandelnden Ärzten einzureichen. Um sicherzustellen, dass der GdB korrekt bewertet wird, ist es empfehlenswert, die gutachtliche Stellungnahme von Fachkundigen überprüfen zu lassen, wie beispielsweise dem DGB Rechtsschutz.
Der Grad der Behinderung hat direkte Auswirkungen auf den Rentenanspruch und die Möglichkeit, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Es ist wichtig, sich der Konsequenzen bewusst zu sein und den Schwerbehindertenausweis rechtzeitig zu beantragen, um die damit verbundenen Vorteile und Unterstützung zu erhalten.
Im Fazit lässt sich sagen, dass die Berechnung des Grad der Behinderung eine komplexe Angelegenheit ist, die sorgfältig und umfassend behandelt werden sollte. Eine gründliche Beurteilung der Auswirkungen der Behinderungen und die Unterstützung von Fachleuten können helfen, den Grad der Behinderung korrekt zu bestimmen und die dafür relevanten Vorteile zu erhalten.